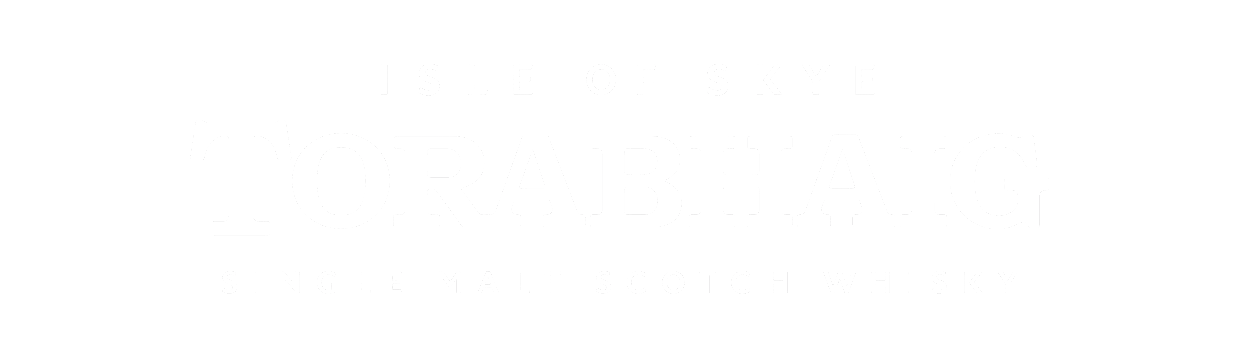Peat Elite-Mitglied Dr. Mike Billett ist als Gastautor mit einem Thema zu Gast, das Ihnen vielleicht bekannt vorkommt: Torf. In einer sechsteiligen Serie nimmt uns Mike mit auf eine Reise in die Moore und beleuchtet die Geschichte des Torfs, seine untrennbare Verbindung zu Scotch Whisky und führt uns noch tiefer in die Welt der Phenole. Unsere Reise führt uns in die 1970er Jahre, eine Zeit großer Experimente, mit einem Zwischenstopp auf der Isle of Skye, bevor wir in die Zukunft blicken, um zu sehen, wie sich die Torfnutzung im weiteren Verlauf des 21. Jahrhunderts entwickeln wird.
Mike ist ausgebildeter Geologe und beschritt einen unkonventionellen und manchmal unvorhergesehenen Weg durch die Boden- und Wasserkunde, um ein bekannter Moorforscher mit einer Professur für Umweltveränderungen zu werden. Von Schottland aus forschte und schrieb er intensiv über die Moore der Britischen Inseln, Skandinaviens und zuletzt der kanadischen Arktis, wobei er sich auf Wasserqualität, Kohlenstoff, Moorbewirtschaftung und Umweltveränderungen konzentrierte.
Seit seinem Rückzug aus der akademischen Welt recherchiert und schreibt er seit drei Jahren ein Buch, das sein Wissen über Torf mit einer seiner Leidenschaften verbindet – Whisky. „Peat and Whisky“ ist kein akademischer Text oder Geschichtsbuch, sondern eine Geschichte über Landschaften, Wissenschaft, Orte, Menschen und ihren Whisky. Es blickt zurück auf ein goldenes Zeitalter von Torf und Whisky und zugleich voraus in eine anspruchsvollere Zukunft.
Ob glücklicher Zufall oder bewusste, geschmackliche Entscheidung: Torf ist ein Wort, das eng mit schottischem Whisky verbunden ist. Der große Whisky-Autor Michael Jackson war überzeugt, dass Torfrauch die wahre Essenz des Scotch sei, und bezeichnete die rauchigen Spirituosen von Islay als „den schottischsten aller Whiskys“. Es war eine harmonische Beziehung, die in rauchigen Hütten und kleinen Bauernhäusern begann und sich über die Jahre hinweg bewährt hat.
Die frühen Destillateure stachten und brannten Torf, um ihre kleinen Brennblasen zu befeuern und ihr Malz zu trocknen. Die fühlbaren Rauchpartikel blieben an der feuchten Gerste haften. Dieser Geruch prägte den Geschmack ihres Spirituosen, und der Torfgeruch wurde zum Synonym für Whisky aus den Highlands und von den Inseln und unterschied ihn von dem minderwertigen Zeug aus den Lowlands, wo man sich für den Brennstoff der Wahl auf lokale Kohle oder gar Holz verließ. Sie produzierten ein Premiumprodukt, das zu einem Premiumpreis verkauft wurde, und sein Ruf war so groß, dass vor über 100 Jahren schwedische und japanische Destillateure nach Schottland reisten, um die Kunst der Herstellung von getorftem Whisky zu erlernen. Schottischer Torf wurde sogar nach Australien verschifft, um zu versuchen, eine Whiskysorte nachzuahmen, die am anderen Ende der Welt gebraut wurde.
Aufzeichnungen zeigen, dass es im späten 19. Jahrhundert in Schottland über 60 aktive Moore gab, die lokale Destillerien und kleine unabhängige Mälzereien mit Torf versorgten. Die jährliche Ernte wurde von Hand gestochen und auf Moos getrocknet und im Spätsommer zu Torfschuppen karrt. Destilleriearbeiter und ihre Familien fanden während der ruhigen Jahreszeit neue Arbeit: Sie reinigten Torfbänke, gruben Gräben aus, schnitten, warfen, stapelten, trugen und karrten. Ihre Namen kommen Ihnen vielleicht bekannt vor, andere nicht: Hobbister Hill (Highland Park), Machrie Moss (Laphroaig), Birnie Moss (Longmorn) und mein Favorit, Faemussach (Glenlivet), „der schmutzige Moor“. Die lokale Versorgung wurde durch große Lieferungen von den Inseln Orkney und Lewis zum Festland ergänzt. Zu den Bestimmungsorten des Orkney-Torfs gehörten Dalmore, Lochnagar, Glenkinchie, Glenturret, Glenmorangie und Ben Nevis – alles Destillerien, die wir heute nicht mehr mit dem Geschmack von getorftem Whisky in Verbindung bringen würden. Es gab einen regen Handel mit Brenntorf und große Mengen wurden auf dem freien Markt gekauft und verkauft.
Der Ausbau des Eisenbahnnetzes im viktorianischen Zeitalter und die Entwicklung der Küstenschifffahrtsrouten in Schottland veränderten das Verhältnis zwischen Torf und Whisky. Kohle war nun leichter verfügbar und lieferte sechsmal mehr Energie als die gleiche Menge getrockneten Torfs. Mit zunehmender Größe der Destillerien wurden kohle- oder indirekt dampfbeheizte Brennblasen zur Norm. Malzdöfen wurden zunehmend mit rauchfreiem Anthrazit, Koks oder mit Torf vermischter Kohle befeuert. Dies fiel mit der Einführung von Blends zusammen, die die Whiskywelt veränderten und neue Konsumenten anzogen, insbesondere in Nordamerika, die einen leichteren, weitgehend ungetorften Whisky bevorzugten.
Schließlich verzichteten viele Brennereien auf ihre arbeitsintensiven Mälzereien und kauften Malz von großen, zentralisierten Produzenten. Die Torfmoore der lokalen Brennereien gerieten außer Betrieb, und die Ernte wurde auf wenige große Moore verlagert, die ihren Torf maschinell stachen. Zum Trocknen des Malzes wurde heiße Luft verwendet, wobei Torfrauch je nach Bedarf über Sekundärbrenner in den Trocknungszyklus ein- und ausgeschaltet wurde.
Doch gerade als sich die Whiskywelt vom Torf abzuwenden schien – man denke nur an die Schließung von Port Ellen, Brora und St. Magdalene, allesamt bedeutende Hersteller von getorftem Whisky –, gewannen in den 1980er Jahren Single Malts an Bedeutung auf dem Markt. Regionalität und Herkunft wurden zu Schlagworten für anspruchsvolle Whiskytrinker, und damit einher ging eine größere Bekanntheit getorfter Single Malts und ein kometenhafter Anstieg ihrer Popularität. Smoky Talisker trat aus dem Schatten und wurde zu einer der bekanntesten Marken der Welt.
Torf und Whisky haben schon immer eine dynamische Beziehung zueinander gehabt. Obwohl die aktuelle Produktion von getorftem Malz nur 10 % der für die Whiskyindustrie produzierten Gerstenmalze ausmacht, lässt sich der Torfrauch durch Erhöhen oder Verringern der Konzentration auf eine Reihe subtiler Geschmacksunterschiede erzeugen. Neue Destillerien konzentrieren sich auf die Herstellung von getorftem Whisky, und regelmäßig erscheinen innovative Rauchmischungen auf dem Markt, die einen kräftigen Kick oder nur eine leichte Torfnote liefern. Wir fügen sogar ungetorften Spirituosen rauchige Aromen und Geschmacksrichtungen hinzu, indem wir Fässer verwenden, in denen zuvor getorfter Whisky lagerte. Ein kreativer Destillateur hat sogar mit der Injizierung von Rauch in Fässer experimentiert. Torf als Brennstoff ist zum Torf als Geschmack geworden.
Trotz aller jüngsten Berichte gibt es keine Anzeichen dafür, dass Whiskyhersteller dem Torf den Rücken kehren. Die Nachfrage nach einer Whiskysorte, die vor 400 Jahren im torfreichen Schottland kreiert wurde, scheint größer denn je.