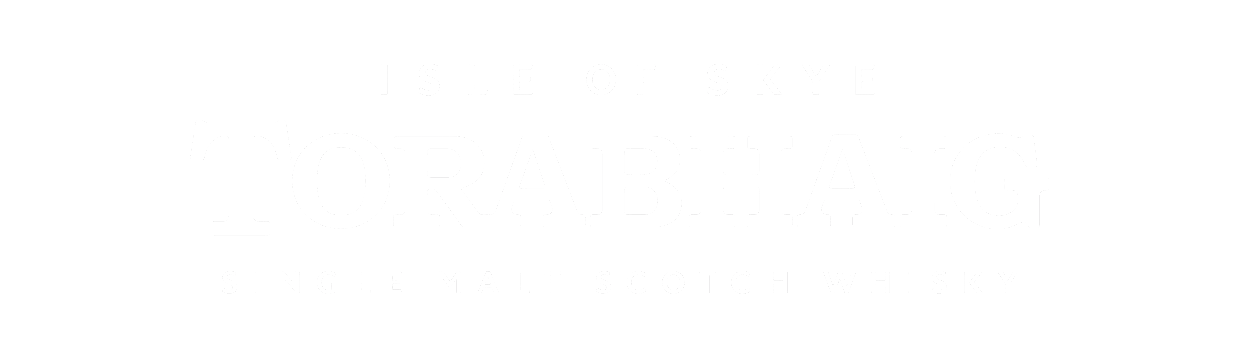Dr. Mike Billett, Mitglied des Torabhaig Clubs und ansässiger Torfliebhaber, kehrt als Gastautor zurück – dieses Mal mit einem tieferen Einblick in eines der geheimnisvollsten Elemente von getorftem Whisky: Phenole.
In diesem neuen Beitrag enthüllt Mike die Wissenschaft hinter dem Rauch – von der Entstehung der Phenole beim Darren bis hin zum Grund, warum derselbe ppm-Gehalt von einem Schluck zum nächsten völlig unterschiedlich schmecken kann. Es bietet einen faszinierenden Einblick in die Geschmacksstoffe, die getorftem Whisky seinen Charakter verleihen – und in die geheimnisvolle Chemie, die „Smoke with Taste“ zugrunde liegt.
Wenn Sie sich also schon einmal gefragt haben, was einen rauchigen Schluck so besonders macht, dann ist dieser hier das Richtige für Sie.
-
Spricht man über rauchigen Whisky, kommt man schnell auf Phenole zu sprechen. Was ist der Torfgehalt – leicht, mittel, stark oder sogar sehr stark? Warum schmecken gleich getorfte Whiskys unterschiedlich? „Auf unglaubliche 152,7 ppm gemälzt“ – was bedeutet das? Zeit, tiefer zu graben, die „Black Box“ zu öffnen, zu erforschen, wie wir Phenole messen und was bei der Whiskyherstellung passiert.
Beim Verbrennen von Torf in einem Darr entstehen verschiedene Verbrennungsprodukte, die mit hoher Energie nach oben zur trocknenden Gerste fliegen: Wasser, Kohlendioxid, Furfural (eine Verbindung mit einem Geschmack, der an Mandeln und süße Kekse erinnert), verschiedene nichtphenolische Kohlenwasserstoffe und die wichtigen Phenole. Die letzten drei sind allesamt Fuselalkohole, die Geschmackselemente des Whiskys. Einige haften am Korn, andere nicht. Die Phenole, die beim Aufbrechen ihrer großen polyphenolischen Vorstufen durch Hitze entstehen, sind klein, leicht und flüchtig und ziehen leicht in die Gerstenspelzen ein, was dem Malz sein rauchiges Aroma und seinen Geschmack verleiht. Erhöhen Sie die Hitze, erhöhen Sie die Luftzirkulation und verwenden Sie feuchten statt trockenen Torf. Verändern Sie die Bedingungen im Darr, und Sie verändern die Aromen im trocknenden Malz, denn die Chemie der Verbrennung entfaltet ihre Wirkung.
Phenolische Verbindungen sind allgegenwärtig. Sie werden auf natürliche Weise von Pflanzen und Mikroorganismen produziert. Sie wurden Ende des 18. Jahrhunderts chemisch identifiziert und 1834 erstmals aus Kohlenteer isoliert. Sie fanden schnell Verwendung und werden bis heute als Antiseptika, Desinfektionsmittel, wirksame Konservierungsmittel und in jüngster Zeit auch als Geschmacksstoffe eingesetzt. Die einfachste Verbindung ist Phenol mit der chemischen Formel C6H5OH – ein Ring aus Kohlenstoffatomen mit einer außen liegenden Hydroxylgruppe (-OH). Etwas verwirrend ist, dass der Name „Phenol“ entweder für diese spezifische Verbindung verwendet werden kann oder als Oberbegriff für die größere Gruppe organischer Verbindungen, zu der es gehört.
Ein Sensorik-Panel wird geschult, einzelne Mitglieder der Phenolgruppe – die sogenannten drei „Phenolfamilien“ – zu erschnüffeln und zu identifizieren. Kresole – starke Antiseptika und Heilmittel; Phenole – sanftere und süßere Varianten der Erste-Hilfe-Kiste; Guajacole – eine geheimnisvollere Gruppe, deren Verbände Gewürze, Kräuter und Duftstoffe enthalten. Kresole und Guajacole besitzen eine zusätzliche Methyl- (-CH3) oder Methoxy- (-OCH3) funktionelle Gruppe am Kohlenstoffring. Diese kann sich frei positionieren, und bemerkenswerterweise beeinflussen diese kleinen Strukturunterschiede die Wahrnehmung der Testpersonen stark. Jede Verbindung hat einen anderen Siedepunkt, und obwohl sich die Phenole als Gruppe erst später im Brennvorgang lösen, kann ein Destillateur an verschiedenen Stellen „schneiden“, um die gewünschten Aromen einzufangen und wichtige Unterschiede im Charakter des neu hergestellten Spiritus zu erzeugen. Die Chemie und Physik des Darrens und der Destillation bestimmen die Aromen und den Geschmack des getorften Spiritus.
1968 veröffentlichte ein Chemiker, der für einen englischen Mälzer arbeitete, eine wissenschaftliche Arbeit, die die Herstellung von getorftem Malz revolutionierte, indem sie eine Methode zur Messung des Gesamtphenolgehalts in ppm (parts per million) entwickelte. Diese Methode wurde nach ihrem Erfinder als „Macfarlane-Methode“ bekannt und umfasste die Extraktion und Oxidation der Phenole vor ihrer Komplexierung mit einem Farbstoff. Je intensiver die Farbe, desto höher die Phenolkonzentration. Im Laufe der Zeit wurde diese einfache kolorimetrische Methode modifiziert und entwickelte sich schnell zum Branchenstandard für die Messung des Gesamtphenolgehalts in getorftem Malz.
Methoden wie die Chromatographie können die „Blackbox“ der Phenole öffnen und ihren Inhalt enthüllen. Sie nutzen Unterschiede in der chemischen Struktur, die Löslichkeit und Flüchtigkeit beeinflussen. Jede Verbindung erscheint als einzelner Peak im Diagramm. Je höher der Peak, desto höher die Konzentration. Vereinfacht ausgedrückt: Phenolverbindungen verhalten sich alle leicht unterschiedlich, und diese Unterschiede werden durch die Hochdruckflüssigkeitschromatographie (HPLC), das bevorzugte Instrument der Industrie, ausgenutzt. Da diese Methode alle oder die meisten wichtigen flüchtigen Phenole identifiziert, ist sie präziser und liefert einen höheren Gesamtphenolwert.
Interessanterweise werden beide Methoden in modernen Whiskylabors nebeneinander angewendet, ohne dass ein einheitlicher Standard vereinbart wurde. Der Phenolgehalt ist für Whiskytrinker mittlerweile ein unverzichtbarer chemischer Aspekt, aber es ist auch wichtig zu wissen, dass für die Vermarktung von getorftem Whisky fast ausschließlich die ppm-Phenolkonzentration der gemälzten Gerste verwendet wird, nicht die endgültige Konzentration im Destillat. Torabhaig stellt eine der seltenen Ausnahmen dar und gibt sowohl die im Getreide enthaltenen Phenole (gemälzte Gerste) als auch die Restphenole (destillierter Alkohol) an, wobei letztere deutlich unter dem Ausgangswert liegen. Wasserzugabe bei der Whiskyherstellung, Entfernung rauchiger Schalen im Fass nach dem Maischen, an Rohren und Gefäßen haftende Phenole, Verluste während der Destillation – all das trägt zum Rückgang der Phenolkonzentration bei. Auch die Reifung schwächt die rauchigen Aromen ab, aber Experten zufolge liegt dies eher am zunehmenden Einfluss anderer, durch das Holz produzierter Fuselalkohole als an einem Rückgang der Phenolkonzentration. Wird der getorfte Single Malt von Torabhaig durch die längere Lagerung im Fass noch wohltemperierter?
Klicken Sie hier , um die früheren Einblicke von Dr. Mike Billet in die Welt des Torfs zu genießen.